Roland Berger ist in den Branchen der Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Sicherheit beratend tätig. Wir unterstützen OEMs, Lieferanten, Agenturen und Investoren.


Aufholjagd im All
Von Manfred Hader
Warum die Raumfahrt eine Schlüsselrolle beim Wiedererstarken der deutschen Wirtschaft spielt
Für moderne Volkswirtschaften wie die deutsche sind weltraumgestützte Lösungen unverzichtbar geworden. Sie helfen dabei, Innovationen zu beschleunigen und neue Märkte zu schaffen, und sie stellen die Resilienz unserer Gesellschaft und Infrastrukturen sicher. Ob in der Logistik und dem Lieferkettenmanagement, bei neuen Mobilitätslösungen und standortbasierten Apps, oder bei der Synchronisierung von Banken und Börsen durch präzise Zeitstempel: Navigations- und Zeitsignale aus dem All spielen eine Schlüsselrolle für moderne Volkswirtschaften.

"Eine starke Raumfahrtwirtschaft ist ein zentraler Wachstumsmotor für die deutsche Industrie. Der Bedarf an einer gemeinsamen Vision, Innovationen und Investitionen ist groß."
Ein Ausfall von Satellitennavigationssystemen hätte beispielsweise schwerwiegende Folgen, wie eine Analyse für die britische Wirtschaft zeigt. Eine Störung von lediglich 24 Stunden würde dort mehr als 1,6 Mrd. Euro kosten. In Deutschland dürfte der Schaden wegen der größeren Wirtschaftsleistung noch höher ausfallen. Ebenso wichtig wie Navigationssignale aus dem All sind eine sichere satellitengestützte Kommunikation und die Versorgung mit Daten, die Erdbeobachtungssatelliten für zivile wie für militärische Zwecke liefern.
Weltraumwirtschaft und Sicherheitspolitik hängen zusammen
Für die europäische Verteidigungsfähigkeit ist die Raumfahrt ebenfalls von essenzieller, strategischer Bedeutung. Weltraumgestützte Dienste sind per definitionem dual use, das heißt, sie können immer sowohl für militärische als auch zivile Zwecke eingesetzt werden. Ein Beispiel: Dasselbe Satellitenbild, das ein Landwirt zur Bewertung der Bodenbeschaffenheit heranzieht, kann auch für eine militärische Analyse verwendet werden, um zu prüfen, ob das Gelände mit schweren Fahrzeugen befahrbar ist.
Private Akteure werden immer wichtiger
Um den Zugang zum Weltraum und seine Nutzung ist daher ein neues Wettrennen entstanden. Staaten und eine stetig wachsende Riege an Unternehmen testen täglich leistungsfähigere Raketensysteme, planen oder betreiben große Satellitenkonstellationen, revolutionieren Starts oder senden immer aufwendigere Robotermissionen ins All. Private Akteure werden in diesem Kräftemessen immer wichtiger, genauso wie die enge Verzahnung der Raumfahrtwirtschaft mit anderen Industrie. Sie alle sind Akteure der „NewSpace“-Ökonomie und sie verfolgen dasselbe Ziel: die Infrastruktur im All zu dominieren und sich damit eine Poleposition im Verteidigungsbereich und der Wirtschaft für die nächsten Jahrzehnte zu sichern.
Der Weltraummarkt wächst rasant
Beim Weltraummarkt unterscheidet man zwischen Upstream und Downstream. Der Upstream-Markt umfasst die Produktion der auf der Erde und im All benötigten Infrastruktur , von Startrampen über Raketen bis hin zu Satelliten. Der Downstream-Markt besteht aus den weltraumgestützten Lösungen - Positioning, Navigation & Timing, Erdbeobachtung und Satellitenkommunikation. Mit rund 408 Mrd. Euro Marktvolumen war der Downstream-Markt im Jahr 2024 deutlich größer als der Upstream-Markt, der auf 63 Mrd. Euro kam. Bei einer prognostizierten Wachstumsrate von 9,3% werden Upstream- und Downstream-Markt zusammen im Jahr 2040 ein Marktvolumen von rund 2 Billionen Euro aufweisen.
Die USA dominieren
Insbesondere in den USA haben die privaten Akteure den Weltraumaktivitäten global die stärkste Dynamik gegeben. Unternehmen wie SpaceX oder Blue Origin investieren mit ihren Gründern Elon Musk und Jeff Bezos Milliardenbeträge in ihre Weltraumambitionen, streben zu Mond und Mars und werden vom Staat mit Aufträgen unterstützt. Die erzielten Ergebnisse geben ihnen recht. SpaceX dominiert mit Starlink die satellitengestützte Kommunikation. Es ist weltweiter mit großem Abstand der Technologieführer bei wiederverwendbaren Raketen. Darüber hinaus ist SpaceX auch der wichtigste Dienstleiter der NASA.
Europa droht, den Anschluss zu verlieren
Eine beeindruckende Entwicklung, doch richtet man den Blick auf Europa und Deutschland, wird klar, dass die Region bei einer Fortschreibung des aktuellen Trends nicht mit der globalen Entwicklung mithalten würde. Ihr prognostiziertes Wachstum liegt nur bei 6,7% (Europa) bzw. 6,4% (Deutschland). Damit würde sich der Weltmarktanteil Europas von 17% im Jahr 2024 auf 12% im Jahr 2040 verringern.
Es muss mehr investiert werden
Was muss passieren, damit Europa seinen Marktanteil halten oder sogar ausbauen kann? Klar ist: Die Investitionen müssen steigen. In unserem optimistischen Szenario, in dem wir annehmen, dass Europa seinen Anteil am globalen Weltraummarkt von aktuell 17% auf 25% im Jahr 2040 steigern wird, müsste Deutschland seine öffentlichen Raumfahrt-Investitionen bis 2040 um 93 Mrd. Euro erhöhen.
Mehr Geld alleine reicht nicht
Mehr Geld alleine wird die Herausforderungen allerdings nicht lösen. Strukturelle Änderungen sind ebenso wichtig. Benötigt werden:
- Ein neues Mindset der Akteure. Politik, Wirtschaft und Bevölkerung muss das enorme wirtschaftliche Potenzial der Raumfahrt und seine Bedeutung für das Wachstum der Industrie insgesamt bewusst sein. Zudem muss es mehr Risikobereitschaft geben, um gute Ideen schnell zum Erfolg zu führen.
- Eine kluge Förderpolitik. Die USA haben es vorgemacht, dass die kommerzielle Raumfahrt floriert, wenn der Staat Ankeraufträge an innovative private Akteure vergibt. Mit Ankeraufträgen behält der Staat die Kontrolle und unterstützt gleichzeitig das Wachstum vielversprechender europäischer Unternehmen.
- Eine strategische Ausrichtung von Investitionen. Investitionen müssen nicht nur groß genug sein, sondern auch die richtigen Ziele verfolgen. Und das heißt, sie müssen Deutschland und Europa stark und unabhängig machen. Im europäischen Bestreben, die eigene Verteidigungsfähigkeit auszubauen, kommt der Raumfahrtwirtschaft eine entscheidende Rolle zu. Und da Weltraumgüter und -dienste Dual-use sind, profitiert davon auch die zivile Wirtschaft.
- Agilere Strukturen und Prozesse. Die fragmentierte europäische Akteurslandschaft muss sich schneller und besser koordinieren, um gegenüber den globalen Wettbewerbern auf Augenhöhe zu agieren. Weltraumagenturen müssen die kommerziellen Potenziale der Raumfahrt in den Vordergrund ihrer Aktivitäten stellen. Europäisches Weltraumrecht darf die Dynamik von NewSpace nicht bremsen, sondern muss als Enabler dienen.
- Europäische und deutsche Souveränität in der Raumfahrt. Europa darf nicht auf Infrastruktur und Dienste aus den USA angewiesen sein. Benötigt werden neben dem europäischen Weltraumbahnhof in Französisch-Guyana auch Launchkapazitäten in Kontinentaleuropa. Bei allen Zukunftstechnologien muss Europa an führender Stelle dabei sein. Wo es aktuell Defizite gibt, sollte bei Technologien Leapfrogging verfolgt werden, um selbst in eine Führungsposition zu gelangen.
- Eine große Vision. Sie muss die Menschen für den Weltraum und seine immensen Potenziale begeistern. Europa bis zum Jahr 2040 zum global führenden Weltraumkontinent zu machen und damit eine Renaissance seiner Kernstärke, der Industrie, zu erzielen, wäre ein starkes Signal, dass es Europa mit seinen Weltraumambitionen ernst meint. Dazu müssen für die Bevölkerung nachvollziehbare Meilensteine definiert und erreicht werden.
Melden Sie sich jetzt an, um die vollständige Publikation zu „Aufholjagd im All“ herunterzuladen. Zusätzlich erhalten Sie regelmäßige News und Updates direkt in Ihre Inbox.
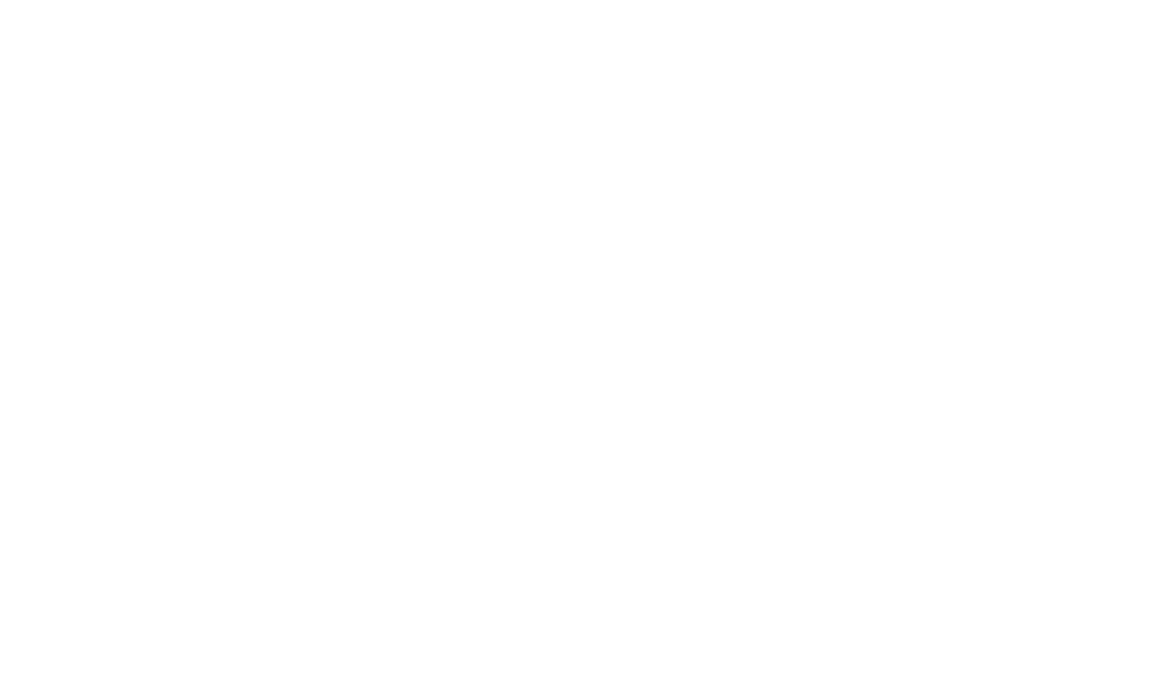


_image_caption_none.jpg?v=1687234)



